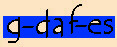
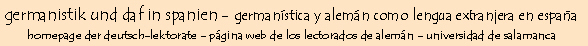






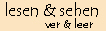










|
Nach der verlorenen Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen vom 22. Mai (Infos dazu hier) kündigte der Bundeskanzler Gerhard Schröder zur Überraschung von Freund und Feind vorgezogene Neuwahlen für den Herbst 2005 an. Begründung: Er müsse die verlorengegangene Legitimationsbasis für seine Politik der Reformen (Stichwort: Agenda 2010) wiederbeschaffen.

Da das Grundgesetz kein Selbstauflösungsrecht des Parlamentes kennt, entschied
sich der Bundeskanzler - nach dem Vorbild von Helmut Kohl 1983 - für
den Ausweg der negativ beantworteten Vertrauensfrage:
Die Koalitionsparteien sollten ihm in einer
extra dafür angesetzten Abstimmung das Vertrauen verweigern
und so den Bundespräsidenten Horst Köhler dazu veranlassen, das
Parlament aufzulösen und Neuwahlen auszuschreiben. Zur Begründung dieses
Manövers verwies Schröder auf Vorbehalte gegen seine Politik in den eigenen
Regierungsfraktionen. Klagen
gegen dieses
verfassungsrechtlich umstrittene Verfahren, die von den
 Bundestagsabgeordneten Werner Schulz (Bündnis 90/Grüne)
und Jelena Hoffmann (SPD)
angestrengt wurden, blieben erfolglos.
Bundestagsabgeordneten Werner Schulz (Bündnis 90/Grüne)
und Jelena Hoffmann (SPD)
angestrengt wurden, blieben erfolglos.
Politische Beobachter reagierten zunächst durchaus mit Bewunderung auf
Schröders Entscheidung, Neuwahlen herbeizuführen, denn man konnte sie als den
Versuch interpretieren, in aussichtsloser Situation - große Teile der
Bevölkerung lehnten die Reformpolitik der Regierung ab, im Bundesrat
scheiterten Gesetzesinitiativen der rot-grünen Regierung häufig an den
Vertretern der CDU-regierten Bundesländer - das Gesetz des
Handelns wieder an sich zu reißen. Als indes in den Umfragen eine
überwältigende Mehrheit für einen Regierungswechsel deutlich wurde, setzte
sich in der Öffentlichkeit der Eindruck durch, Schröder suche auf Kosten
seiner Partei, der er sich ohnehin nicht verbunden fühle, den spektakulären
 Abgang - zumal nicht einsichtig wurde, was ein eventueller Wahlsieg von
Rot-Grün an der für die Regierung ungünstigen politischen Gesamtsituation
ändern könnte. Außerdem wurde kritisch gefragt, warum die Bürger einer Partei
die Stimme geben sollten, deren Vertreter im Bundestag zuvor von ihrem
eigenen Kanzler für unzuverlässig erklärt worden waren.
Abgang - zumal nicht einsichtig wurde, was ein eventueller Wahlsieg von
Rot-Grün an der für die Regierung ungünstigen politischen Gesamtsituation
ändern könnte. Außerdem wurde kritisch gefragt, warum die Bürger einer Partei
die Stimme geben sollten, deren Vertreter im Bundestag zuvor von ihrem
eigenen Kanzler für unzuverlässig erklärt worden waren.
Gingen daher die Regierungsparteien - die SPD mehr als die Grünen - mit
massiven Argumentationsproblemen in den ungewohnt kurzen Wahlkampf, schien die
schwarz-gelbe Opposition (CDU/CSU und FDP) sich
trotz eines nach wie vor stabilen Umfragevorsprungs zunehmend selbst zum
Problem zu werden. So hatte die Herausforderin Angela Merkel, der mangelndes
Charisma attestiert wurde, im konservativen bürgerlichen Lager mit einer
zähen unterschwelligen Abneigung zu kämpfen; darüberhinaus musste sie sich
 den Querschüssen des 2002 als Herausforderer Schröders gescheiterten
Chefs der bayerischen Schwesterpartei CSU, Edmund Stoiber,
erwehren. Auch gelang es der Union letztlich nicht, eine die Bevölkerung
überzeugende Reformalternative zu formulieren. In vielen Politikbereichen
werden die Antworten der Opposition auf die drängenden Fragen -
Arbeitslosigkeit, fehlendes Wirtschaftswachstum, Überalterung der
Gesellschaft - als ebensowenig schlüssig wie die der amtierenden Regierung
wahrgenommen. Es kam hinzu, dass der Vorschlag, nach der Wahl die Mehrwertsteuer zu
erhöhen - vital für das Reformkonzept der Union -, bei dem designierten
Koalitionspartner FDP auf erbitterten Widerstand stieß. Auch die
den Querschüssen des 2002 als Herausforderer Schröders gescheiterten
Chefs der bayerischen Schwesterpartei CSU, Edmund Stoiber,
erwehren. Auch gelang es der Union letztlich nicht, eine die Bevölkerung
überzeugende Reformalternative zu formulieren. In vielen Politikbereichen
werden die Antworten der Opposition auf die drängenden Fragen -
Arbeitslosigkeit, fehlendes Wirtschaftswachstum, Überalterung der
Gesellschaft - als ebensowenig schlüssig wie die der amtierenden Regierung
wahrgenommen. Es kam hinzu, dass der Vorschlag, nach der Wahl die Mehrwertsteuer zu
erhöhen - vital für das Reformkonzept der Union -, bei dem designierten
Koalitionspartner FDP auf erbitterten Widerstand stieß. Auch die
 Berufung des Juristen und Steuerrechtlers Paul Kirchhof in das
sogenannte ,Kompetenzteam"
der Union, die zunächst als großer Coup gefeiert wurde, erwies sich zunehmend
als Eigentor, weil das von ihm vorgeschlagene revolutionäre Steuerkonzept -
ein Einheitstarif für alle - nicht einmal von der CDU/CSU unterstützt wird.
Und schließlich konnte selbst ein ausgesprochen guter Auftritt Merkels im
Fernsehduell mit dem Bundeskanzler nichts daran ändern, dass Schröder von
vielen in Deutschland nach wie vor als die überzeugendere Persönlichkeit
eingeschätzt wird.
Berufung des Juristen und Steuerrechtlers Paul Kirchhof in das
sogenannte ,Kompetenzteam"
der Union, die zunächst als großer Coup gefeiert wurde, erwies sich zunehmend
als Eigentor, weil das von ihm vorgeschlagene revolutionäre Steuerkonzept -
ein Einheitstarif für alle - nicht einmal von der CDU/CSU unterstützt wird.
Und schließlich konnte selbst ein ausgesprochen guter Auftritt Merkels im
Fernsehduell mit dem Bundeskanzler nichts daran ändern, dass Schröder von
vielen in Deutschland nach wie vor als die überzeugendere Persönlichkeit
eingeschätzt wird.
Trotzdem wäre angesichts der als katastrophal empfundenen wirtschafts- und
 arbeitsmarktpolitischen Bilanz der Regierung Schröder der schwarz-gelbe Sieg
kaum zu gefährden gewesen, wenn nicht im Sommer 2005 mit der Linkspartei
ein neuer politischer Akteur
aufgetaucht wäre, der die Kalkulationen der großen Lager gründlich
durcheinanderbrachte. Die Linkspartei, ein unter dem Druck des Wahltermins
zustandegekommener Zusammenschluss von ostdeutscher PDS und westdeutscher
"Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit" (WASG),
die ihrerseits eine Antwort
linker Gewerkschafter, teilweise auch linker Sozialdemokraten auf die
Agenda-2010-Politik der SPD ist, versteht sich als grundsätzliche Opposition
zum "neoliberalen" Kurs von rot-grün und schwarz-gelb. Würde die
Linkspartei in den Bundestag einziehen, wäre das besonders pikant, weil mit
ihr Oskar Lafontaine, der ehemalige SPD-Parteivorsitzende und
Kurzzeit-Finanzminister im ersten Kabinett Schröder, wieder die
bundespolitische Bühne betreten würde: Lafontaine bildet zusammen mit Gregor
Gysi von der PDS das publikumswirksame Führungsteam der Linkspartei. Ein
Erfolg für diese junge Gruppierung wäre daher in mehrfacher Hinsicht ein
harter Schlag für die SPD, er könnte aber - je nachdem, wie hoch er ausfällt
- auch den lange Zeit als sicher geglaubten Sieg der schwarz-gelben
Opposition vereiteln. So ist im Moment (fast) alles offen: Sieht man von den
beiden Optionen rot-rot-grün und der sogenannten ,Ampel" zwischen SPD, FDP
und Bündnis 90/Die Grünen ab, die von den Akteuren ausgeschlossen werden,
könnte am Ende eine Bestätigung der amtierenden Regierung stehen - die
unwahrscheinlichere Variante -, ein Sieg der schwarz-gelben Opposition - die
wahrscheinlichere Variante - oder aber die große Koalition, vermutlich unter
einer Bundeskanzlerin Angela Merkel. Oder aber es werden noch einmal, diesmal
auf Betreiben der Union, Neuwahlen herbeigeführt - dieses in der letzten
Woche vor der Wahl plötzlich aufgekommene Gerücht wurde von der Unionsspitze
allerdings umgehend dementiert.
arbeitsmarktpolitischen Bilanz der Regierung Schröder der schwarz-gelbe Sieg
kaum zu gefährden gewesen, wenn nicht im Sommer 2005 mit der Linkspartei
ein neuer politischer Akteur
aufgetaucht wäre, der die Kalkulationen der großen Lager gründlich
durcheinanderbrachte. Die Linkspartei, ein unter dem Druck des Wahltermins
zustandegekommener Zusammenschluss von ostdeutscher PDS und westdeutscher
"Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit" (WASG),
die ihrerseits eine Antwort
linker Gewerkschafter, teilweise auch linker Sozialdemokraten auf die
Agenda-2010-Politik der SPD ist, versteht sich als grundsätzliche Opposition
zum "neoliberalen" Kurs von rot-grün und schwarz-gelb. Würde die
Linkspartei in den Bundestag einziehen, wäre das besonders pikant, weil mit
ihr Oskar Lafontaine, der ehemalige SPD-Parteivorsitzende und
Kurzzeit-Finanzminister im ersten Kabinett Schröder, wieder die
bundespolitische Bühne betreten würde: Lafontaine bildet zusammen mit Gregor
Gysi von der PDS das publikumswirksame Führungsteam der Linkspartei. Ein
Erfolg für diese junge Gruppierung wäre daher in mehrfacher Hinsicht ein
harter Schlag für die SPD, er könnte aber - je nachdem, wie hoch er ausfällt
- auch den lange Zeit als sicher geglaubten Sieg der schwarz-gelben
Opposition vereiteln. So ist im Moment (fast) alles offen: Sieht man von den
beiden Optionen rot-rot-grün und der sogenannten ,Ampel" zwischen SPD, FDP
und Bündnis 90/Die Grünen ab, die von den Akteuren ausgeschlossen werden,
könnte am Ende eine Bestätigung der amtierenden Regierung stehen - die
unwahrscheinlichere Variante -, ein Sieg der schwarz-gelben Opposition - die
wahrscheinlichere Variante - oder aber die große Koalition, vermutlich unter
einer Bundeskanzlerin Angela Merkel. Oder aber es werden noch einmal, diesmal
auf Betreiben der Union, Neuwahlen herbeigeführt - dieses in der letzten
Woche vor der Wahl plötzlich aufgekommene Gerücht wurde von der Unionsspitze
allerdings umgehend dementiert.
Einige Weblinks zur Bundestagswahl 2005:
Aktuelle Informationen zur Wahl auf den Seiten des deutschen Bundestages:
http://www.bundestag.de/wahl2005/index.html
Zahlreiche weitere Informationen zur Bundestagswahl und vor allem alle
Ergebnisse (die aber erst ab Sonntag, dem 18.9., 18 Uhr!) auf der Seite des
Bundeswahlleiters:
http://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahl2005/downloads/
Die unabhängige Seite www.politik-digital.de gibt den Nichtwählern eine
Stimme:
http://www.politik-digital.de/
Ausführliche Analysen, Informationen und Hintergrundberichte bieten die
Specials der deutschen Qualitätspresse:
http://www.zeit.de/politik/wahlen
http://www.sueddeutsche.de/
http://www.faz.net/s/homepage.html
g-daf-es
Startseite - Página principal | Lektorate - Lectorados | Projekte - Proyectos | Lesen & Sehen - Ver & leer | Specials - Especiales | Links - Enlaces | Chancen - Oportunidades | Archiv - Archivo | Suche - Búsqueda | Sitemap - Mapa del sitio | Impressum - Acerca de ésta página |
letzte Aktualisierung: 17. September 2005
actualizada: 18 de septiembre de 2005